-
Pflege mit Herz
Empathie in den Pflegeberufen
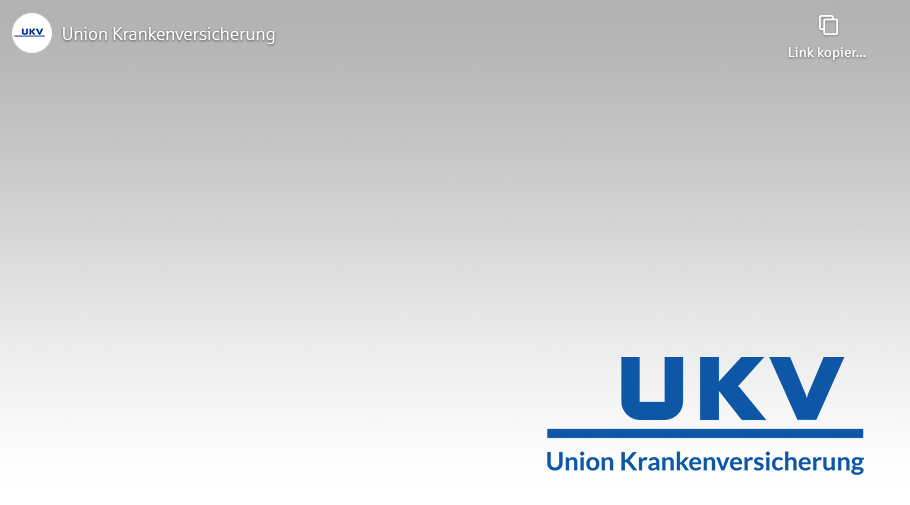
Hier wird ein Video nicht angezeigt
Mit Klick auf den Button „Zustimmen“ willigen Sie ein, dass eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch YouTube auch in Drittstaaten außerhalb der EU und EWR erfolgt, auch wenn diese Drittstaaten über kein nach EU-Standards ausreichendes Datenschutzniveau verfügen. Weitere Informationen zum Datentransfer durch YouTube finden Sie hier. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
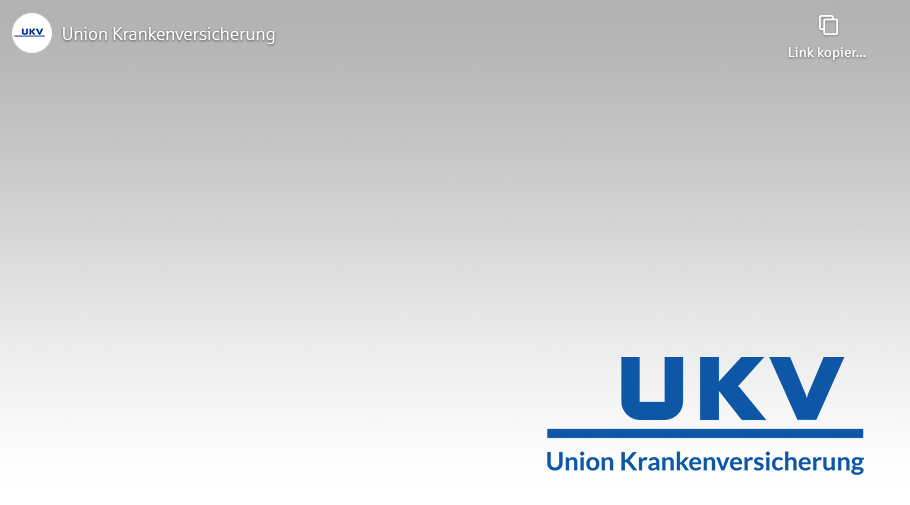
Sie haben einer Datenübertragung zu YouTube auf unserer Homepage nicht zugestimmt. Mit Klick auf den Link werden Sie aus diesem Grund direkt weitergeleitet zu YouTube. Betreiber von YouTube ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie hier in deren Datenschutzerklärung.
Weiter zu YouTubeEmpathie ist eine häufig geforderte Fähigkeit. In vielen Berufen ist sie von Vorteil, für den Pflegeberuf sogar Voraussetzung. Der „rappende Pfleger“ Ferdi Cebi verbreitet diese Botschaft mit seiner Musik – und lebt danach in seinem Alltag in einem Altenpflegeheim. Er möchte sensibilisieren und andere in ihrem Einfühlungsvermögen unterstützen. Dass man Empathie auch lernen kann, ist mittlerweile wissenschaftlich bestätigt und wird im Forschungsprogramm empCARE untersucht.
Ferdi Cebi ist seit über fünfzehn Jahren Altenpfleger im St. Johannisstift Paderborn. Bekannt geworden ist er nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch eine Begegnung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. 2017 lud er sie im Rahmen einer Wahlsendung zu einem Besuch in seinem Altenheim ein. Und tatsächlich verbrachte die Bundeskanzlerin einen Vormittag bei Ferdi Cebi im St. Johannisstift und ließ sich den Pflegealltag zeigen. Seitdem gehört der nebenberufliche Musiker zu den bekanntesten Pflegern Deutschlands.
Einfühlungsvermögen als Grundvoraussetzung
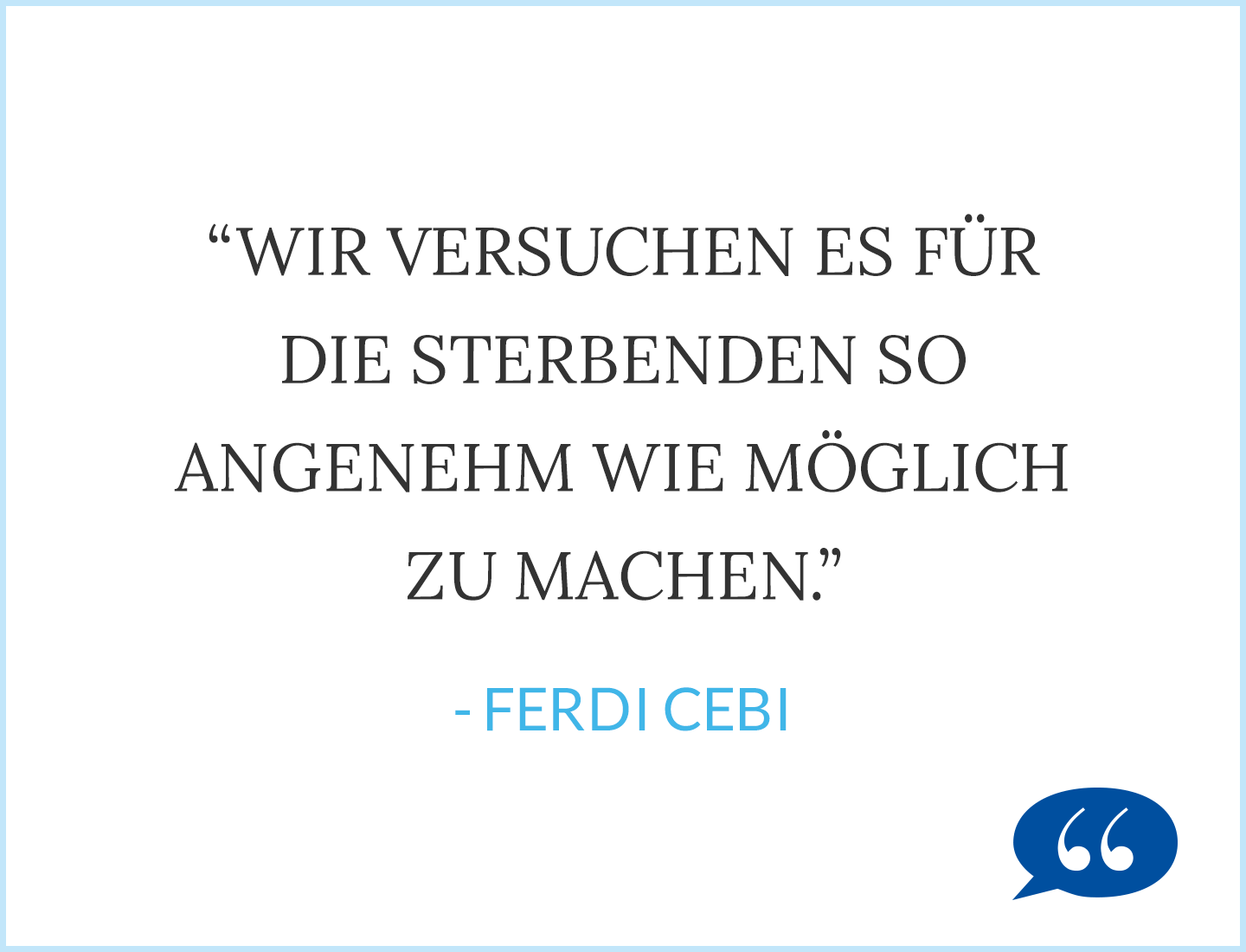
Die Konfrontation mit dem Tod, Hilfsbedürftigkeit und der Umgang mit Ängsten, das sind alltägliche Herausforderungen an die Empathie von Pflegekräften. Krankenhäuser und Altenheime werben daher mit Bildern für neues Pflegepersonal, welche die gesellschaftlichen Erwartungen an Pflegende zum Ausdruck bringen. Da sitzen Pflegerinnen geduldig am Bett eines Patienten, spielen Schach mit einem Heimbewohner oder sind in ein Gespräch mit Angehörigen vertieft. Das Bedürfnis zu helfen ist die Hauptmotivation zum Erlernen eines Pflegeberufs.
Im hektischen Berufsalltag kollidieren die gesellschaftlichen und persönlichen Erwartungen mit herausfordernden Situationen. Das kann Pflegende an ihre Grenzen stoßen lassen. Dann wird sichtbar, dass Empathie auch eine Schattenseite hat. Wenn immer wieder emotionale Überforderung im Umgang mit Patienten, Angehörigen oder Heimbewohnern erlebt wird, kann es zu klassischen Belastungsfolgen wie Berufsunzufriedenheit, psychosomatischen Symptomen oder Burn-out kommen.
Empathie im Überblick
Empathie wird zumeist als Einfühlungsvermögen verstanden: Die Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse des Gegenübers können erkannt und nachempfunden werden. In der neurobiologischen Forschung wird zwischen empathischem Leid und Mitgefühl unterschieden. Es wurde festgestellt, dass diese beiden Komponenten in unterschiedlichen Hirnregionen verarbeitet werden. Empathisches Leid führt zu einer hohen Erregung ungefähr in der Hirnregion, wo beim Rhesusaffen Spiegelneurone gefunden wurden. Mitgefühl kann als Sorge um den anderen verstanden werden, verbunden mit der Motivation zu helfen. Mitfühlendes Handeln setzt voraus, dass das empathische Leid nicht zu sehr ausgeprägt ist: Nur wer beim Anblick eines gebrochenen Beins oder einer sozialen Zurückweisung nicht in Schockstarre gerät, kann mitfühlend reagieren.Das Training empCARE vermittelt einen gesunden Umgang mit Empathie
Gerade in emotional schwierigen Situationen wollten Pflegende zwar zugewandt und einfühlsam reagieren. Aus einem Überforderungsgefühl heraus verhielten sie sich jedoch gegenteilig. Sie würden schroff, unempathisch oder speisten ihr Gegenüber mit Sätzen wie „Kopf hoch“ oder „Wird schon wieder“ ab. Marius Deckers bezeichnet diese Reaktionsweise als empathischen Kurzschluss: „Solche Kurzschlüsse entstehen, wenn starke Gefühle wie Trauer, Verzweiflung oder Angst im Spiel sind. Wenn beispielsweise ein sterbenskranker Patient fragt, ob er wieder lebend das Krankenhaus verlassen wird.“
Das Training fokussiere, dass die Teilnehmenden ein Gespür für solche empathischen Kurzschlüsse entwickelten und lernten, nicht impulsiv mit Pseudo- oder Nicht-Empathie zu reagieren. Dies könne gelingen, wenn auch die eigenen Bedürfnisse wahrgenommen und anerkannt würden. Ein Beispiel: Die Pflegerin könnte bei der Frage eines sterbenskranken Patienten seine Angst wahrnehmen und spüren, dass es ihr selbst einen Stich versetzt. Das könnte sie zum Ausdruck bringen und dadurch würde ein Moment echter Nähe möglich.
O-Ton: Dr. Marius Deckers zum Problem des "empathischen Kurzschluss"
Der Einfluss von Rahmenbedingungen auf Empathie in der Pflege
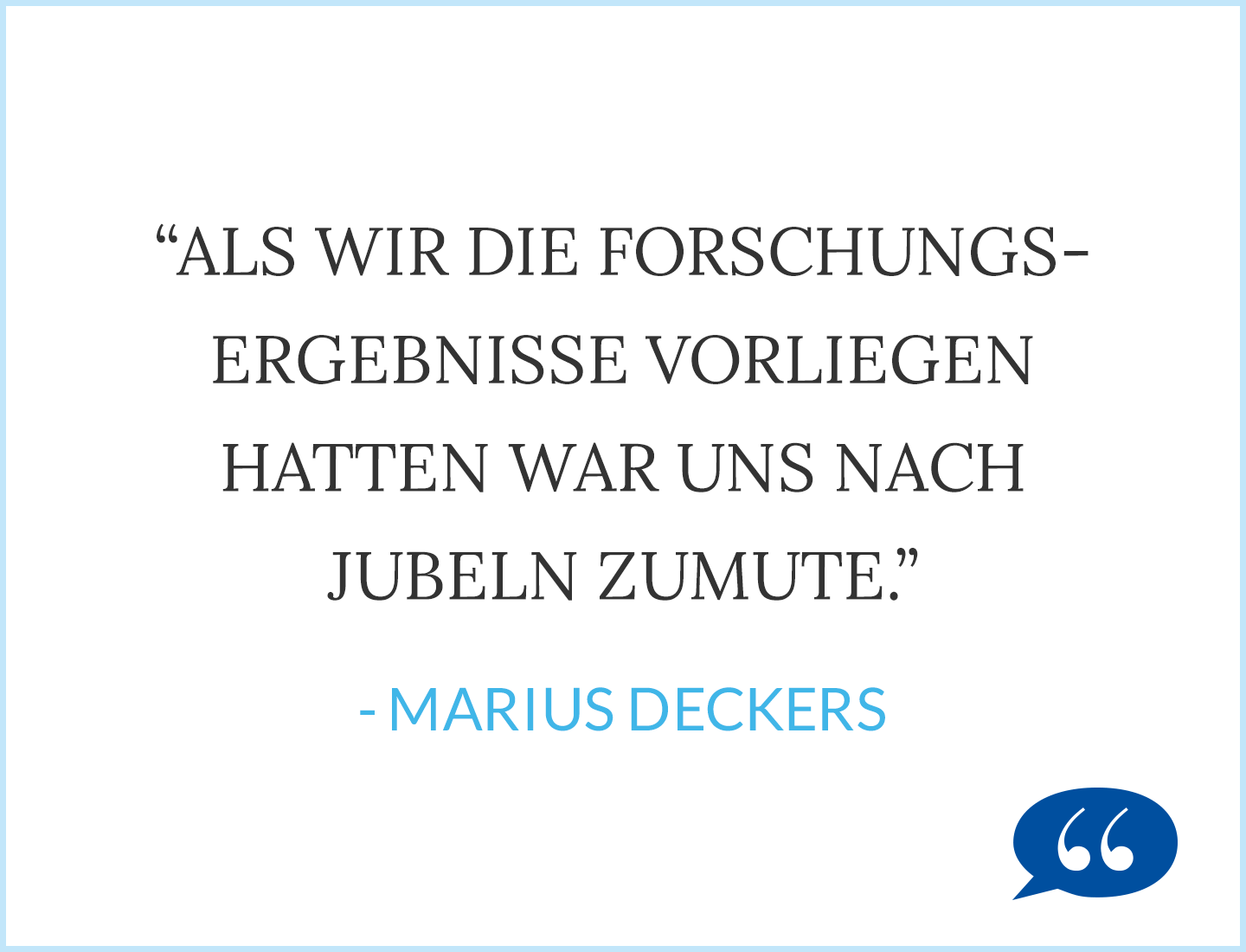
Die Ergebnisse hätten unabhängig von der Persönlichkeit und den Arbeitsbedingungen der Teilnehmenden Bestand, betont Deckers: „Rahmenbedingungen wie Teamgröße oder die Stimmung im Arbeitsteam haben nach jetzigem Forschungsstand nur einen sehr geringen Einfluss auf den empathischen Umgang mit Patienten, Heimbewohnern oder Angehörigen.“ Damit wolle er den Einfluss von Rahmenbedingungen auf den Berufsalltag von Pflegenden nicht bagatellisieren. Personalmangel, sich ständig ändernde Dienstpläne oder überfüllte Pflegestationen könnten vielmehr das Problem der Pseudo- und Nichtempathie noch verstärken: „Die gute Nachricht ist, dass ein mitfühlender Umgang auch in Stresssituationen gelingen kann.“
Tipps von empCARE-Trainer Marius Deckers
- Besonders in emotionalen Situationen: Erstmal tief durchatmen. So lässt sich der Impuls der ersten Reaktion verhindern.“
- Was Sie brauchen und wie Sie sich fühlen ist genauso wichtig wie die Emotionen und Bedürfnisse Ihres Gegenübers. Beides wahr- und anzunehmen, ist der Schlüssel für einen mitfühlenden Umgang mit dem anderen, aber auch mit sich selbst.“
Gewaltfreie Kommunikation
Das Forschungsprogramm empCARE basiert auf dem Konzept der Gewaltfreien Kommunikation, die von dem Psychologen und Mediator Marshall Rosenberg (1934 - 2015) entwickelt wurde. Die Gewaltfreie Kommunikation setzt sich aus vier Faktoren zusammen: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte.
Veröffentlicht am 16.04.2020
Schnell weiter im Text

